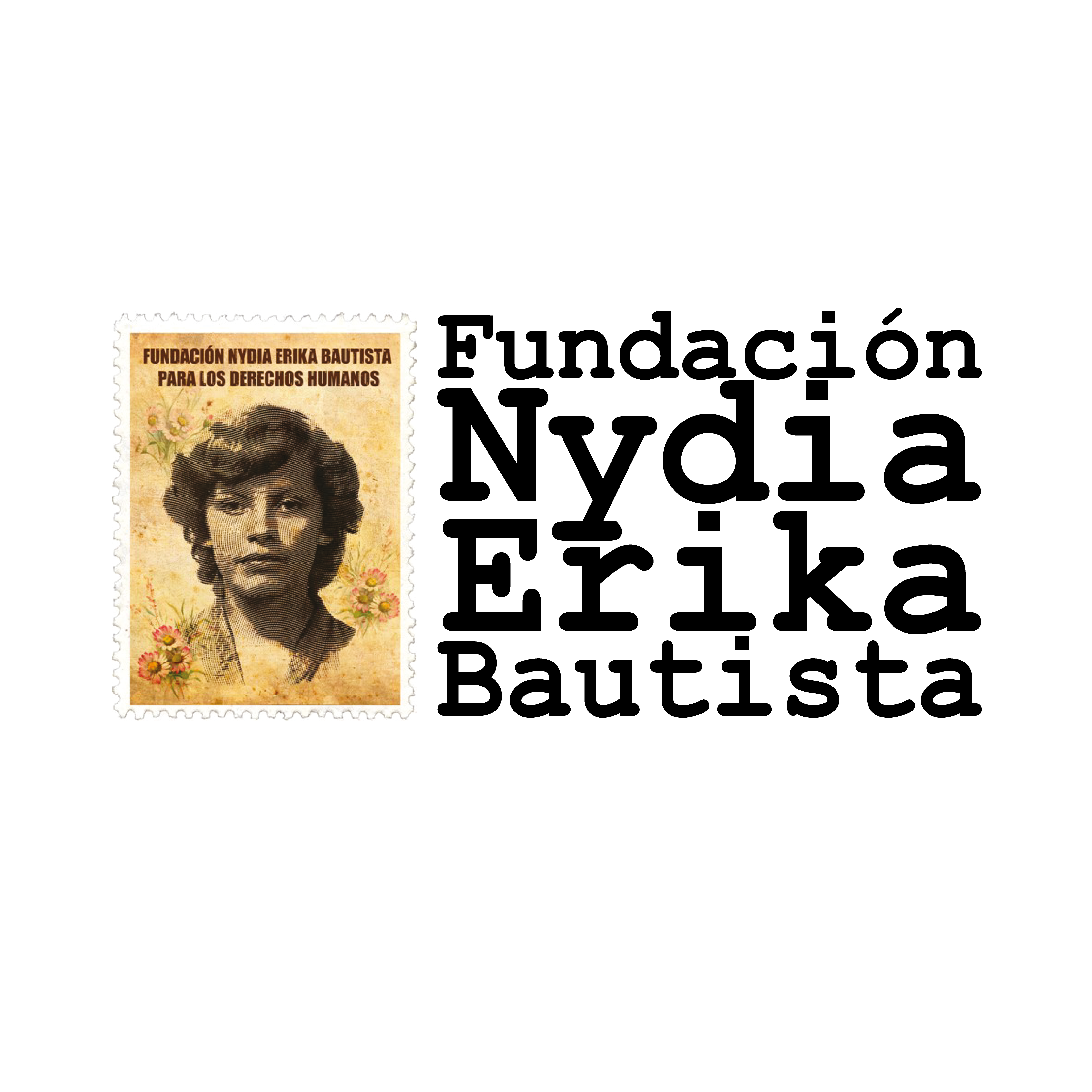Uribe, der Unversöhnliche
Er hat es wieder getan. Álvaro Uribe, Ex-Präsident Kolumbiens und heute einflussreicher Senator, sollte im Parlament eigentlich Auskunft geben über seine angeblichen Verbindungen zu rechten Verbrecherorganisationen. Die Paramilitärs waren im Bürgerkrieg verantwortlich für Morde, Vertreibungen und andere Menschenrechtsverletzungen. Darüber, ob manches davon auf Wunsch oder im Auftrag Uribes begangen worden ist, wird schon lange spekuliert.
Doch statt den anderen Senatoren Antworten auf ihre Fragen zu geben, griff Uribe seine politischen Gegner direkt an. Sie stünden mit der Guerilla im Bunde, erklärte er. Und er nannte Namen: den des aktuellen Präsidenten Juan Manuel Santos und des linken Senators Iván Cepeda zum Beispiel, der die Debatte zum Paramilitarismus beantragt hatte. Dann erwähnte Uribe noch die Menschenrechtsaktivistin Yanette Bautista. Beweise für seine Anwürfe legte er keine vor.
Wer von Uribe derart angegangen wird, lebt in Gefahr – in einem Land, in dem Gewalt bis heute ein übliches Mittel ist, um Konflikte zu lösen. Der Ex-Präsident besitzt immer noch eine große Autorität und er ist ein geschickter Kommunikator. Seine Macht nutzt er, um den kolumbianischen Friedensprozess zu torpedieren, wo immer er kann.
Oft bleibt er Belege schuldig, doch viele glauben ihm. «Durch seine Vorwürfe legitimiert Uribe Gewalt gegen die von ihm als Guerilleros bezeichneten Personen», sagt Christian Voelkel, Kolumbien-Analyst beim Thinktank International Crisis Group in Bogotá. «Das Risiko, dass sie in Gefahr geraten, ist sehr real.»
Yanette Bautista lebt unter noch größerer Anspannung als zuvor, seit Uribe ihren Namen im Senat erwähnte. Wenn sie vor die Tür geht, begleiten sie Leibwächter, und durch die Stadt bewegt sie sich in einem gepanzerten Wagen. Bautista leitet eine Stiftung, die sich um die Rechte von im Bürgerkrieg verschwundenen Kolumbianern und ihrer Angehörigen kümmert. Was die Familien Verschwundener durchmachen müssen, hat sie selbst erlebt: Ende der achtziger Jahre wurde Yanettes Schwester Nydia Érika Bautista von Soldaten entführt, gefoltert und umgebracht. Erst Jahre später erhielt die Familie Nydias Überreste zurück. Bis heute ist der Fall strafrechtlich nicht aufgeklärt, die verantwortlichen Militärs sind immer noch im Dienst.
Yanette Bautista will sich damit nicht zufrieden geben, sie fordert Aufklärung, für sich und die Angehörigen anderer Verschwundener und eine Anerkennung ihres Leids. Darüber hinaus engagiert sie sich für den Abschluss eines Friedensvertrags zwischen der kolumbianischen Regierung und der Guerilla der Farc. Möglicherweise ist das der Grund dafür, dass Uribe auch sie als Guerillera bezeichnete. Bautista bezeichnet seine Anschuldigungen als völlig haltlos.
Auch Ex-Präsident Uribe, dessen Vater einst von Farc-Guerilleros ermordet wurde, ist gegen einen Friedensvertrag. Nach der Senatsdebatte verbreitete er seine Beschuldigungen auch auf Twitter, wo ihm mehr als drei Millionen Menschen folgen. Yanette Bautista sei eine Guerillera der ELN und immer noch aktiv, schrieb Uribe, und er twitterte von einem «Anführer Federico». Federico ist die spanische Variante des Vornamens Friedrich – so heißt Bautistas Mann, ein Deutscher, der in Kolumbien für eine internationale Entwicklungsorganisation arbeitet.
Jetzt fühlt sich die Familie bedroht. Wer sich in Kolumbien für die Verschwundenen einsetzt und mögliche Verantwortliche öffentlich benennt, ist ohnehin in einer exponierten Lage. In manchen Regionen riskieren Menschenrechtler durch ihre Arbeit täglich ihr Leben – und Yanette Bautista war schon eine in der Öffentlichkeit bekannte Figur, bevor Uribe ihr vorwarf, Guerillera zu sein. Jetzt hat sich der Druck auf sie noch einmal erhöht. Das mache mürbe, sagt sie am Telefon. «Damit zu leben, strengt nicht nur mental unglaublich an. Es hat mich auch körperlich krank gemacht.»
Aufzugeben ist für sie dennoch keine Option. «Ich habe 25 Jahre lang für die Sache der Verschwundenen gearbeitet. Ich werde mich jetzt nicht überwältigen lassen. Und wir haben auch eine große Solidarität erfahren, durch Nachrichten aus dem ganzen Land.» Kolumbien habe durch die Friedensverhandlungen eine historische Chance, sagt Bautista. Die ganze Wahrheit über den Konflikt müsse endlich ans Licht, «damit wir eine andere Gesellschaft schaffen können, für künftige Generationen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Uribe das verdirbt.»
Der unversöhnliche Ex-Präsident aber wird wohl auch weiter gegen den Frieden trommeln und ein großer Teil der Bevölkerung steht hinter ihm. In den Augen vieler Kolumbianer wären Uribe und seine Gefolgsleute mit ihrem Konfrontationskurs viel besser geeignet, die Sicherheit im Land zu garantieren als der amtierende Präsident Santos. Deshalb wird Kolumbien so schnell keinen Frieden finden, selbst wenn der von vielen lang ersehnte Friedensvertrag bald kommt.